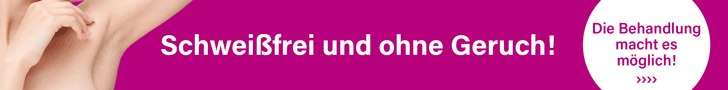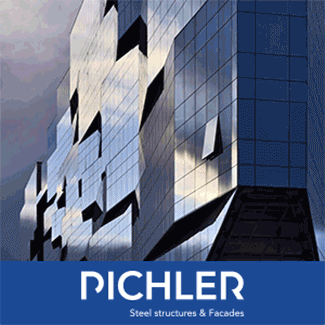SWZ: Im Sommer haben Sie im Gespräch mit Rai Südtirol gesagt, Südtirol sei ein kleines Spielgebiet und Laboratorium für europäische Verhältnisse. Wie würden Sie diese Verhältnisse derzeit beschreiben?

Stefan Pan*: Der Kontinent steht vor einer Zeitenwende, die sich mit einem neuen Narrativ bzw. einer neuen Wahrnehmung von Wirklichkeit erklärt. Die Geschichten, die wir uns bisher erzählt haben, fußten auf zwei Elementen. Erstens: „Europa ist das Zentrum der Welt.“ Das gilt auch für Südtirol. Wir hatten bzw. haben einen starken Hang dazu, Südtirol als Insel zu sehen.
Und zweitens?
„Wir brauchen keine Industrie mehr.“ Gerade die aktuelle Kommission zeichnete die Vision einer postindustriellen Gesellschaft. Tatsächlich aber gibt es weltweit andere Entwicklungen – und das ist die Zeitenwende. Es gibt Player, die unglaublich an Stärke zugelegt haben: China, Indien, die USA. Sie alle stellen die Industriepolitik in den Mittelpunkt, denn sie wissen, dass die Industrie über den größten Wertschöpfungshebel verfügt.
Was genau leistet die Industrie denn?
Sehr viel – besonders auch in Europa. Der starke Sockel, auf dem die europäische Gesellschaft steht, wird wesentlich von der Industrie gestützt. Jene zehn Regionen, die im regionalen Wettbewerbsindex Europas am besten abschneiden, haben gemeinsam, dass der BIP-Anteil der Industrie weit mehr als 20 Prozent ausmacht. Mehr als 80 Prozent der Forschung und Entwicklung gehen von der Industrie aus. Und der Austausch von Bildungseinrichtungen mit Unternehmen ist in industriellen Regionen besonders fortgeschritten.
Die Industrie schafft so die Grundlage für etwas, wofür das europäische Modell nach wie vor einzigartig ist: sieben Prozent der Weltbevölkerung, etwa 20 Prozent des Welt-BIPs – Tendenz sinkend – und 40 Prozent der weltweiten Sozialleistungen. In Zeiten des demografischen Wandels ist es umso wichtiger, diesen Sockel zu erhalten. Wenn wir es nicht schaffen, überdurchschnittlich Wertschöpfung zu generieren, werden wir morgen nicht imstande sein, Krankenhäuser, Schulen, Sozialleistungen zu finanzieren.
Wie stehen die Chancen, dass wir das schaffen?
Bis vor Kurzem wurde Industrie ausgeblendet. Wir sind dabei, die Industrie, das europäische Tafelsilber, zu verschenken, nur um es dann verschmutzt zurückzukaufen. Wir nehmen zu oft eine beschränkte Perspektive ein, da wir nur die kleinen Kreisläufe sehen. Dadurch verkennen wir die Möglichkeit, diese in die großen einzubinden. Allein sind die kleinen Kreisläufe aber nicht überlebensfähig.
Die Diskussion mit der EU-Kommission ist außerdem geprägt von einer abwehrenden Haltung und sie setzt Maßnahmen, die planwirtschaftlich sind, die Industrie entkoppeln und das Prinzip der Technologieoffenheit verschmähen. Es werden nicht mal Richtlinien erlassen, sondern Verordnungen, die kaum Spielraum lassen in der nationalen Umsetzung – etwa die Luftrichtlinie. Sollte sie so kommen, müssen drei Viertel der Unternehmen in der Po-Ebene zusperren. Es ist klar, dass wir sensibel mit der Umwelt umgehen müssen, aber wir dürfen das globale Umfeld nicht außer Acht lassen. Wenn wir leistungsfähig bleiben wollen, aber uns selbst durch Überregulierung lähmen, verlieren wir die Fähigkeit, als Gesellschaft zu überleben.
Es ist wirklich dramatisch. Italien hat ca. 25 Millionen Arbeitsplätze, zehn Millionen davon sind besetzt durch Menschen über 55 Jahre. Da sieht man, in welche Richtung wir steuern. Umso mehr brauchen wir hohe Technologieschübe für die Industrie.
Bis vor Kurzem, sagen Sie – hat sich daran etwas geändert?
Eine Wende auf europäischer Ebene war erkennbar mit dem Auftritt von Ursula von der Leyen im Jänner in Davos, als sie zum ersten Mal in ihrer Präsidentschaft das Wort „Industrie“ wieder in den Mund genommen und auf deren Wichtigkeit aufmerksam gemacht hat. Das Bewusstsein ist seitdem stärker geworden. Man spricht mittlerweile vom Net-Zero Industry Act und der Notwendigkeit, Überregulierung zurückzufahren. Die letzten Programme der EU, die jetzt aufgelegt werden, gehen alle in die Richtung, dass die Notwendigkeit der Wettbewerbsfähigkeit erkannt wird. Plötzlich klingeln die Alarmglocken und man versucht, die Perspektive zu wechseln.
Wie steht es um die Wertschätzung der Industrie in Südtirol?
Hierzulande ist Sensibilität gegeben für Tourismus, Handwerk und Landwirtschaft, kaum aber für Industrie. Ja, wir haben eine mustergültige Landwirtschaft, auf die wir alle stolz sind, aber sie schafft nur fünf Prozent des BIP. Das verarbeitende Gewerbe schafft mit einem Bruchteil des Grundes 25 Prozent, also fünfmal so viel.
Das ist in den Köpfen aber noch nicht angelangt. Denken Sie an die Diskussion um Alpitronic, ein hochtechnologisches Unternehmen. Die Haltung ist „Not in my Backyard“, nicht in meinem Garten. Wenn wir die Sozialleistungsgeneratoren unseres Landes verschicken, wird es düster, denn ohne sie wird sich der demografische Wandel nicht bewältigen lassen.
Kurzum: Wir müssen kleine Kreisläufe wieder stärker in große integrieren.
Wie kann dieses Integrieren der kleinen Kreisläufe in die großen konkret aussehen?
Indem wir wieder Industriepolitik machen. Es braucht, und das ist die große Herausforderung der Politik, Rahmenbedingungen, die es den Unternehmen erlauben, wieder schnell sein zu können, sich wieder bewegen zu können.
Europa ist ein überregulierter Kontinent. Der französische Unternehmerverband Medef hat beim jüngsten Treffen von BusinessEurope eine Studie über die aktuelle EU-Kommission präsentiert. Diese hat 850 Richtlinien erlassen, die massiv ins unternehmerische Leben eingreifen. 5.422 Seiten an Regulatorien, die es in den USA nicht gibt, in China nicht, in Indien nicht.
Welchen Spielraum hat Südtirol angesichts der Richtlinien aus Brüssel?
Indem es den Dialog sucht – auf nationaler Ebene, aber auch auf europäischer. Wir machen das über die Verbände. Wir versuchen, Aufbruchstimmung zu vermitteln. Noch haben wir viel von unserem Tafelsilber, das wir pflegen können und müssen.
In Südtirol ist die Politik gefordert, denken wir nochmal an Alpitronic. Will ich ein Umfeld garantieren, das Unternehmen hochschätzt und anerkennt, welche Leistungen diese erbringen, gerade auch für den Landeshaushalt, oder fahre ich eine Linie, die mehr ein Narrativ der landwirtschaftlichen Idylle zeichnet, das aber nicht nachhaltig ist? Nachhaltigkeit besteht eben nicht nur aus der ökologischen Komponente, sondern auch aus der ökonomischen und sozialen.
Was Südtirol noch tun kann: die Gewerbe- und Industriegebiete nicht zur Mischnutzung freigeben. Die Flächen für die Industrie sind ohnehin stark begrenzt.
Wie kann mehr Bewusstsein geschaffen werden für die Industrie?
Durch ständige Diskussion und Austausch, denn Dialog ist der Königsweg für demokratische Entwicklung und für Bewusstseinsbildung in einer Gesellschaft. Wir müssen klar machen, dass Industrie die Substanz der Demokratie darstellt, wie es Joachim Gauck formuliert hat. Ohne Leistungsfähigkeit im sozialen und ökonomischen Umfeld können wir uns auch Demokratie nicht leisten.
Auf EU-Ebene ist es uns bereits gelungen, die Industrie wieder zu thematisieren und die Überregulierung offen anzusprechen. Das sollte in Südtirol genauso sein.
Südtirol bekommt bald eine neue Landesregierung. Was wünschen Sie sich von dieser aus wirtschaftlicher Sicht?
Den Blick fürs Ganze und dass das Zusammenspiel der Wirtschaftsfaktoren, die Südtirol so stark gemacht haben, weiterverfolgt wird, mit der Erkenntnis, dass die Industrie dabei die gewichtigste Rolle spielt. Die Kuh, die am meisten Milch gibt, soll man entsprechend pflegen. Ein konkretes Zeichen dafür wäre, die Irap wieder unbürokratisch zu senken, wie es in Vergangenheit bereits getan wurde und im Trentino vorgelebt wird.
Lassen Sie uns auf die nationale Ebene wechseln. Italiens Schuldenberg wächst unaufhaltsam. Wird er früher oder später zum Problem für Europa?
Das ist ein ganz aktuelles Thema. Der Stabilitäts- und Wachstumspakt, der im Zuge der Pandemie aufgehoben wurde, soll mit Jahresende wieder greifen. Der Name offenbart aber bereits das Grundproblem. Es müsste ein Wachstums- und Stabilitätspakt werden, denn nur Wachstum ermöglicht es, die Entwicklung zu drehen und den Schuldenberg zurückzubauen.
Das Um und Auf wird sein, auf den richtigen Hebel zu setzen. Wichtiger als die Investitionen an sich ist der Reformplan, der damit verbunden ist. Auf italienischer Ebene brauchen wir Maßnahmen, die schnell greifen, und am schnellsten greifen die, die über die Unternehmen abgewickelt werden können.
Können Sie ein Beispiel nennen?
Den bisher größten Wachstums- und Investitionsschub brachte der „Piano Industria 4.0“ unter der Regierung Renzi, der mit Steuerguthaben arbeitete.
Confindustria hat daher das Programm „Industrie 5.0“ lanciert, das auf Digitalisierung und Ausbildung in den Unternehmen abzielt. Gerade in den unterentwickelten Regionen im Süden haben wir über ein ähnliches Programm viel bewirkt. In einem Jahr wurde ein Investitionsvolumen von neun Milliarden Euro aktiviert – ohne Bürokratie, ohne Ausschreibungen. So etwas macht ein Land resilient.
Deshalb unsere Forderungen: Maßnahmen, die automatisch erfolgen, die keine Bürokratie schaffen und die die Unternehmen stärken.
Die osteuropäischen Mitgliedsstaaten konnten zuletzt zum EU-Schnitt aufschließen. Der Abstand jener sieben italienischen Regionen, die als wirtschaftlich schwach entwickelt gelten, hat sich hingegen vergrößert. Das Istat benennt als Gründe des Niedergangs die niedrige Beschäftigungsquote und die niedrige Produktivität. Wie lautet Ihre Einschätzung?
Polen hat die Kohäsionsmittel sehr gut eingesetzt und den BIP-Anteil pro Mitarbeiterin bzw. Mitarbeiter stark in die Höhe getrieben. Es ist ein Musterbeispiel dafür, wie es funktioniert. Im Süden sind viele Gelder über Ausschreibungen vergeben worden, die über kleine Gemeinden erfolgen, welche nicht die technischen Mittel haben, um diese abzuwickeln.
Durch die Flexibilisierung der EU-Programme ist es nun aber möglich geworden, hier anders vorzugehen. Die EU ist dafür, die doppelte Herausforderung – digital und grün zu werden – unbürokratisch über die Unternehmen abzuwickeln. Das ist der Königsweg.
Derzeit eröffnet sich in der EU eine weitere Diskussion in Hinblick auf die Staatsschulden.
Die da wäre?
Es gibt Länder, die besser dastehen und entsprechend stärker mit Staatshilfen arbeiten können. Andere Länder können das nicht. Wir müssen schauen, dies durch EU-Investitionen zu kompensieren, damit nicht zusätzliche Spannungen innerhalb des europäischen Binnenmarktes entstehen.
Denken Sie, dass Europa, das häufig als alte Frau gezeichnet wird, die auf Krücken geht, sich nochmal erholen kann und zu neuem Leben erwacht?
Ich sehe ein anderes Bild: Europa ist eine starke, junge Athletin, die durch Überregulierung festgebunden ist, aber nur darauf wartet, wieder loslaufen zu können und in ihrem Lauf alle mitnehmen wird.
Interview: Sabina Drescher
* Stefan Pan, Jahrgang 1959, führt das Unternehmen Pan Tiefkühlprodukte mit Hauptsitz in Leifers und Standorten in den USA und der Schweiz. Seit 2020 ist er Confindustria-Beauftragter für Europa, seit vergangenem Jahr zudem Vizepräsident von BusinessEurope, Europas bedeutendstem Arbeitgeberdachverband.
Dieser Artikel ist in der gedruckten SWZ mit folgendem Titel erschienen: „Wir verschenken unser Tafelsilber“.