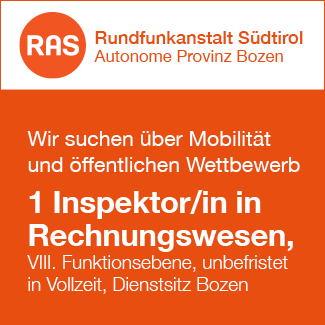Reizthema Arbeitssicherheit
ARBEITSUNFÄLLE – Letzthin haben einige Urteile erneut gezeigt, wie weitläufig das Thema Arbeitssicherheit ist. Vor allem die bestehenden Haftungsrisiken stehen immer wieder im Mittelpunkt der Streitigkeiten. Teil der Diskussion ist auch die Unfallstatistik des Inail.
Josef Tschöll
Der Arbeitsrechtexperte der SWZ. Mitinhaber der Kanzlei RST mit Sitzen in Sterzing, Brixen und Eppan. Genießt in Fachkreisen hohes Ansehen und gilt als einer der Top-Arbeitsrechtexperten in Italien.
Verwandte Artikel
Innsbrucker Straße 23
39100 Bozen
Italien
info@swz.it
(+39) 0471 973 341