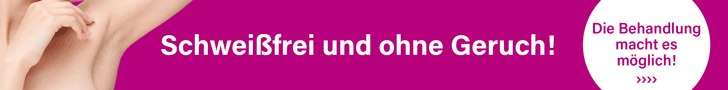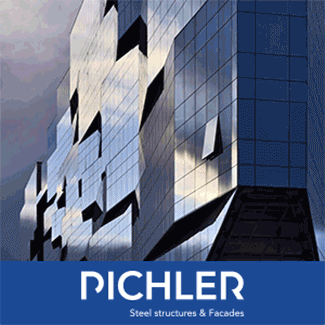In-vitro-Lebensmittel: Labor statt Kuhstall?
IN-VITRO-LEBENSMITTEL – Ist es bald nicht mehr notwendig, Rinder, Schweine oder Hühner zu halten, um Fleisch zu erzeugen, oder Fangflotten auszusenden, um Fisch auf dem Speisenplan zu haben? Möglicherweise! Die technische Erzeugung solcher Lebensmittel macht enorme Fortschritte. Umstritten ist, ob dies die Lösung vieler Probleme ist.
Verwandte Artikel
Innsbrucker Straße 23
39100 Bozen
Italien
info@swz.it
(+39) 0471 973 341