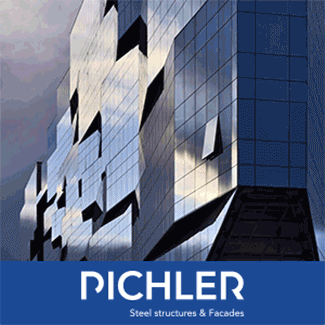Nur freiwillig
GEMEINDEN – Gemessen an der Einwohnerzahl sind Südtirols Gemeinden relativ klein. Um die Dienstleistungen für die Bürger dennoch bestmöglich zu gewährleisten, fördert das Land nun die zwischengemeindliche Zusammenarbeit. Doch warum werden kleine Gemeinden nicht zusammengeschlossen oder in größere integriert?
Verwandte Artikel
Innsbrucker Straße 23
39100 Bozen
Italien
info@swz.it
(+39) 0471 973 341